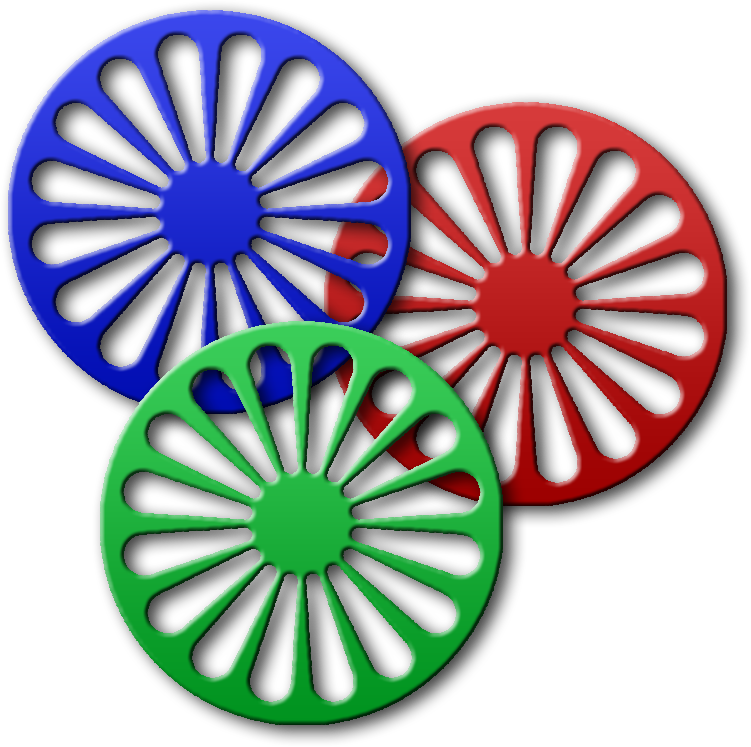Von der Notwendigkeit, das Vorurteil vom „Sozialtourismus“ abzubauen
Einblicke in die Sozialberatung von Romano Sumnal
Erschienen in: Roma und Sinti in Sachsen: Eine vergessene Minderheit? Leipzig: Romano Sumnal e.V., 8. April 2023
von Harika Dauth
Der Begriff „Sozialtourismus” war im Jahr 2013 das Unwort des Jahres. Zehn Jahre später ist dieser Begriff wie sein Synonym der „Armutszuwanderung” in öffentlichen Debatten nach wie vor präsent. Und bis heute diskriminieren diese Begrifflichkeiten die Gesamtheit der Minderheit der Rom*nja. Denn selbst wenn bei der Verwendung der Begriffe „Sozialtourismus“ und „Armutszuwanderung“ Rom*nja und Sinti*zze oft nicht direkt genannt werden und stattdessen politisch opportunere Pauschalisierungen − wie aktuell „Bulgaren und Rumänen” − zum Einsatz kommen, haben Medien eine Verbindung zu Europas größter ethnischer Minderheit meist so direkt hergestellt, dass sie mittlerweile zum Synonym für Rom*nja geworden sind. Doch mit der Realität hat die medial kolportierte Diskriminierung faktisch nichts zu tun – im Gegenteil. Der folgende Artikel zielt darauf ab, ein gängiges Vorurteil der Gegenwart am Beispiel von Rom*nja- Arbeiter*innen in der Fleischindustrie zu entkräften. Die hier verarbeiteten Informationen basieren auf eigenen Recherchen und Erfahrungsberichten von Betroffenen in den neuen Bundesländern.
Nach Deutschland zieht es Rom*nja aus der EU häufig für die Arbeit mit dem Fleisch1. Gerade EU-Bürger*innen ohne anerkannte Qualifikation, die verzweifelt nach Arbeit suchen, werden hier häufig auch ohne Deutschkenntnisse fündig. Denn aufgrund der immer stärker schwindenden Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung, die körperlich herausfordernde Arbeit im Niedriglohnsektor zu tätigen, liegt die Einstellung zugewanderter Arbeiter*innen auch im Interesse der Arbeitgeber. Wie es zunächst aussieht, eine Win-Win-Situation für die Unternehmen und die Arbeitssuchenden. Auch die Verbraucher*innen profitieren von der gering bezahlten Arbeit, denn ohne die Niedriglohnarbeiter*innen müssten sie wesentlich höhere Preise für ihr Fleisch zahlen, das laut dem Fleisch-Atlas in keinem anderen Bundesland so viel verzehrt wird wie in Sachsen2. Doch die Arbeiter*innen, darunter auch viele Rom*nja, zahlen oftmals einen hohen Preis, wie im Folgenden aufgezeigt werden soll.
In einem Unternehmen XY3 der Fleischindustrie, arbeiten alle Arbeiter*innen, darunter auch viele Rom*nja, im Zweischichtsystem. Die Frühschicht beginnt um 5 Uhr und endet um 14:00 Uhr; die Spätschicht beginnt um 14:30 und endet oft erst nach Mitternacht. Die Arbeiter*innen erzählen in der Sozialberatung, dass sie regelmäßig unbezahlte Überstunden machen müssen. Die Überstunden tauchen dabei zwar teilweise auf ihren Lohnzetteln auf, aber laut der Arbeiter*innen, nur unvollständig. Dennoch beschweren sie sich nicht darüber beim Arbeitgeber*innen, denn sie haben Sorge, ihre Stelle zu verlieren. Die Arbeit ist zu kostbar, sie ernährt ihre Familien. Manchmal gehen beide Elternteile arbeiten, manchmal nur der Vater, manchmal nur die Mutter. Bei allein Erziehenden kommt eine Mehrfachbelastung hinzu, weil sie für die Arbeitszeiten, in denen ihre Kinder nicht durch Schule oder Kindergarten betreut werden, eine zusätzliche Betreuung für ihre Kinder finden müssen. Regelmäßig müssen die Arbeiter*innen auch am Wochenende arbeiten. Trotz der hohen Arbeitsbelastung möchten viele der Arbeiter*innen aus der EU ihre Arbeit behalten, denn sie ahnen, dass sie ohne Deutschkenntnisse kaum eine andere Arbeitsstelle finden würden. Sie möchten gerne Deutsch lernen, doch dafür bleibt in der langen Arbeitswoche keine Zeit.
Ankommen ohne Willkommen
Die Ankunft in den neuen Bundesländern gestaltet sich für die Arbeiter*innen oftmals als enorme Herausforderung. Die erste Hürde besteht darin, günstigen Wohnraum für die Familien zu finden. Der Fleischbetrieb selbst stellt nur einige wenige Unterkünfte. Die meisten Neuankömmlinge suchen daher Wohnraum in den nächstgelegenen Ortschaften und Städten.
In Sachsen beispielsweise war bereits Ende 2017 jeder dritte zugewanderte Mensch aus der EU4, darunter auch viele Angehörige der Rom*nja. In ihren Herkunftsländern gehören Rom*nja häufig Minderheiten an und sprechen teilweise andere Muttersprachen als die Angehörigen der Bevölkerungsmehrheit. Dass die Menschen aus EU-Staaten zu uns kommen, ist in der lokalen Bevölkerung oft nicht bekannt. Nicht selten werden EU-Bürger*innen als Asylbewerber*innen wahrgenommen und diskriminiert.
Die Skepsis gegenüber Menschen aus osteuropäischen Ländern ist hoch, das ist auch in den Behörden immer wieder spürbar. Als ich unlängst im Namen einer Romni aus Bulgarien, die zu unserer Offenen Sprechstunde kam, bei einer Behörde anrief, um eine*n Dolmetscher*in für einen Gesprächstermin zu erfragen, begann die Sachbearbeiterin die Frau zu verdächtigen, weil ihre Muttersprache Türkisch und nicht Bulgarisch war. „Wieso hat die Frau, wenn sie türkisch spricht, einen bulgarischen Pass, den hat sie sich doch bestimmt irgendwo besorgt! Das kommt mir komisch vor…” Kommentare wie diese sind keine Seltenheit in den neuen Bundesländern.
In einer Kleinstadt eines neuen Bundeslandes, deren Name hier zum Schutz der Betroffenen nicht genannt wird, leben viele der zugewanderten EU-Bürger*innen zusammen mit dezentral untergekommenen Geflüchteten, Spätaussiedler*innen und alteingesessenen und/oder sozial benachteiligten Menschen in einem räumlich separierten Stadtteil. Die Mehrheitsbevölkerung macht einen Bogen um den Stadtteil, weil sie dort Kriminalität und Chaos vermuten − ein Vorurteil, das von lokalen Medien immer wieder neu belebt wird. Wer in der Kleinstadt in der Zeitung „Schandflecke in unserer Stadt” liest, weiß bereits vor dem Lesen des Artikels, welcher Stadtteil damit gemeint ist. Ähnliche Schlagzeilen wie „Müll, Lärm, Kriminalität” bedienen bereits im Titel drei antiziganistische Vorurteile, vermutlich, ohne dass das den Medienmacher*innen bewusst ist. Vorherrschend in dem separierten Stadtteil sind vor allem graue, teilweise marode wirkende Wohnblöcke und die Tatsache, dass so gut wie keine soziale Infrastruktur vor Ort existiert. Es gibt außer in den Schulen keine Sozialarbeiter*innen und keine Anlaufstelle für Jugendliche, die direkt oder indirekt durch die Stadt organisiert oder finanziert ist. Eine Ausschreibung für eine Streetworker-Stelle ist seit über drei Jahren vakant. Trotz der guten Bezahlung findet die Stadt niemanden, der die Stelle alleine besetzen möchte. Ansprechpartner*innen für soziale Belange der vor allem nicht deutschsprachigen Anwohner*innen sind stattdessen zwei Streifenpolizisten, die regelmäßig durch das Quartier gehen.
Massen von Papier
In der Kleinstadt angekommen, beginnt für die zugewanderten Rom*nja ein neues Leben. Es ist ein Leben, in dem es viele Papiere gibt − und viel mehr Post als in ihren Herkunftsländern. Im Laufe einiger Monate haben die Arbeiter*innen teilweise mehrere Taschen mit Papieren angehäuft, die sie in der Regel nicht lesen können und uns zum Übersetzen in die Sprechstunde bringen.
Dann gibt es wiederum Papiere, die dringend benötigt werden, aber nicht immer einfach zu bekommen sind. Eines dieser Papiere ist die Wohnungsgeberbestätigung. Das Dokument ist Voraussetzung für die Anmeldung in der Kommune, ohne die praktisch nichts läuft. Denn ohne Anmeldung kein Bankkonto, keine Schulanmeldung für die Kinder, kein Antrag auf Kindergeld, usw. Das Papier gibt es nur mit einem abgeschlossenen Mietvertrag. Doch auch wenn es diesen gibt, vergehen manchmal Monate, bis die Rom*nja aus der EU das Papier in den Händen halten.
Vor Ort haben wir in den vergangenen Jahren versucht, die Arbeiter*innen in diesen Belangen zu unterstützen. Wir dolmetschten für sie am Telefon, in Arztpraxen und Behörden. Wenn wir in ihrem Namen lokale Vermieter*innen anriefen, hörten wir regelmäßig rassistische Aussagen wie z.B.: „Slowaken nehmen wir nicht mehr”. Auf Nachfrage hieß es, es gebe Müllprobleme, Beschwerden von Anwohner*innen, und die Wohnungen seien häufig überbelegt worden. Überhaupt gebe es aktuell keine freien Wohnungen. Gleichzeitig lässt die Stadt Objekte rückbauen, weil angeblich der Bedarf an Wohnraum fehlt. Doch ohne freie Wohnungen gibt es weitere Überbelegungen und Zwangsräumungen. Ein Kreislauf, der zu Prekarisierung führt.
Wohnraum ohne Warmwasser, Heizung und Strom
Neu ankommende, akut Wohnraum suchende Rom*nja sehen sich häufig gezwungen, in Wohnblöcke mit maroder Infrastruktur zu ziehen, zu denen es leichtere Zugänge gibt. Diese Wohnblöcke sind, wie auch im Fall zweier Wohnblöcke der Kleinstadt, im Besitz von Immobilienfirmen in deutschen Großstädten und werden nicht vor Ort verwaltet. Die Bewohner*innen sind weitestgehend sich selbst überlassen. Reparaturen veranlassen die Immobilienfirmen, wenn überhaupt, nur notdürftig. In den vergangenen Jahren vermieteten sie Wohnungen ohne Strom an Neuankömmlinge, den Netzbetreiber*innen teilweise erst Monate später freischalteten. Bis heute leben Menschen dort ohne funktionierende Heizsysteme, teilweise auch wochenlang ohne Warmwasser; die Mieten werden seit Jahren in bar von Angestellten der Immobilienfirma eingefordert, ohne dass Quittungen ausgestellt werden. Im vergangenen August brannte es in einem der Wohnblöcke. Fünf Personen wurden verletzt, zehn Wohnparteien mussten evakuiert werden. Die ermittelnde Behörde schloss einen Defekt als Brand-Ursache aus. Es wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Wir wissen von mindestens einer Rom*nja-Familie, die keine Unterstützung durch die Vermieter-Firma oder die Stadt bei der Suche nach einer Ersatzunterkunft erhielt. Auch in solchen Umständen müssen die Arbeiter*innen weiterarbeiten. Auf erschwerte Lebensumstände wird keine Rücksicht genommen. Doch die Lebensumstände erschweren das Arbeiten. Und manchmal sind sie die Ursache dafür, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird.
Die Kündigung
Viele der Arbeiter*innen erhalten bereits während ihrer sechsmonatigen Probezeit eine Kündigung. Wenn es Abmahnungen gibt, kommen diese häufig unmittelbar vor der Kündigung oder auch gleichzeitig mit ihr zusammen. Mitunter ist darin die Rede davon, dass der/die Angestellte unentschuldigt gefehlt hätte. Fehlzeiten können tatsächlich auftreten, weil ein zuverlässiger Transport zur Arbeit nicht immer gewährleistet ist. Der Öffentliche Nahverkehr ist teuer und fährt teilweise zu den Schichtarbeitszeiten noch nicht oder nicht mehr. Die Arbeiter*innen müssen sich deshalb in Fahrgemeinschaften organisieren. Fallen die Fahrer*innen dieser Fahrgemeinschaften z.B. aufgrund von eigener Krankheit oder Krankheit der Kinder aus, gibt es oft keinen Ersatz, schon gar nicht in den frühen Morgenstunden. Arbeiter*innen, die auf die Fahrer*innen angewiesen sind, stehen dann ohne Transport da und bekommen daraufhin eine Abmahnung, oder eben eine Kündigung. Das Problem könnte durch ein Shuttle-Angebot des Unternehmens gelöst werden, welches dieses aber bislang nicht bereit ist, für die Unionsbürger*innen zur Verfügung zu stellen. Die neuen Arbeiter*innen, die über eine Agentur aus der Ukraine angeworben wurden, kommen jedoch in eben einem solchen Shuttlebus zur Arbeit. Die Ungleichbehandlung fällt auf.
In der Fabrik ist es kalt, weil das Fleisch gekühlt werden muss. Die Arbeiter*innen stehen den ganzen Tag. Sie erzählen, dass es zwei Pausen am Tag gibt: einmal zehn Minuten, einmal zwanzig Minuten. Manche werden nach mehreren Monaten krank. Sehr häufig erhalten die Arbeiter*innen dann eine Kündigung, teilweise auch dann, wenn sie ihr Fehlen (rechtzeitig) entschuldigen. In der Regel reichen die Arbeiter*innen ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis eines Arztes oder einer Ärztin ein. Manche schaffen es nicht, weil sie keinen Arzttermin bekommen.
Krankenversichert ohne Zugang zu medizinischer Versorgung
In der Kleinstadt gibt es zu wenige Hausärzt*innen. Das ist für die Neuzuwander*innen ein ernstes Problem, denn ohne Arztbesuch bekommen sie keine Krankmeldung, und ohne Krankmeldung kommt die Kündigung. Nicht vorhandene Krankmeldungen durch den Arzt ziehen auch Folgen nach sich, wenn die Kinder der Arbeiter*innen erkranken. Denn die unentschuldigten Fehltage in der Schule ziehen teure Bußgeldbescheide wegen „Schulbummelei” nach sich. Wer die nicht bezahlen kann, bekommt im Ernstfall, wie im Falle einer uns bekannten Romni, eine Androhung auf Erzwingungshaft.
Wenn wir für die Arbeiter*innen telefonisch Arzttermine organisierten, war es nie klar, ob ein Arzttermin zustande kommen würde. Häufig bekamen wir unfreundliche Absagen wie: „Wir können ja hier nicht alle aufnehmen!“ Wenn wir einen Termin bekamen, waren alle erleichtert. Doch auch dann wurden Rom*nja teilweise wieder nach Hause geschickt, wenn sie ohne Dolmetscher*innen kamen. Dolmetscher*innen zu finden ist schwer. Weder die Arztpraxen noch die Kommunen stellen Dolmetscher*innen zur Verfügung. Soziale Kontakte zu deutschsprachigen Menschen haben die Arbeiter*innen kaum. Die wenige Freizeit, die ihnen neben dem Arbeiten bleibt, verbringen sie in der Regel mit ihren Familien. So nehmen die Betroffenen mitunter notgedrungen ihre Kinder zum Dolmetschen mit. Oder fahren in dringenden medizinischen Fällen in ihre Herkunftsländer zu Ärzt*innen ihres Vertrauens.
Der Faktor Mensch im reibungslosen Betrieb
Wir haben uns oft gefragt, weshalb so viele Arbeiter*innen Kündigungen erhalten. Ist es verwaltungstechnisch nicht sehr aufwendig, immer wieder neue Mitarbeiter*innen einzustellen? Das Muster war immer wieder dasselbe: Wer nicht zeigt, dass er pausenlos effektiv arbeiten kann, wer nicht mobil genug ist, wer krank wird oder gar einen Arbeitsunfall hat, wer sich zu sehr um andere sorgt oder wer um nahe Angehörige trauert, bekommt eine Kündigung. Selbst wenn Arbeiter*innen einen Kurzurlaub beantragen, um kranke oder im Sterben liegende nahe Verwandte in ihren Herkunftsländern zu besuchen, und selbst wenn sie diesen Kurzurlaub gewährt bekommen, haben sie teilweise nach ihrer Rückkehr nach Deutschland eine Kündigung im Briefkasten. Das Unternehmen XY möchte einen möglichst störungsfreien und ertragreichen Ablauf ihres Betriebes sicherstellen. Arbeiter*innen, die ausfallen, möchten sie sich nicht leisten. Dabei wird auch vor Schwangeren kein Halt gemacht. Kündigungsschutz-Rechte nehmen Arbeiter*innen in Anspruch genommen, sofern sie bekannt sind. Das ist aufgrund eines strukturellen Sozialberatungsmangels in den neuen Bundesländern häufig nicht der Fall.
In der Regel geht der schriftlichen Kündigung eine mündliche Kündigung voraus. Laut den Arbeiterinnen sagt der Vorgesetzte dem/der Arbeiter*in dann beispielsweise, dass er/sie morgen nicht mehr auf Arbeit kommen muss. Die schriftliche Kündigung greift aber aufgrund der Kündigungsschutzfristen erst Wochen später. Grundsätzlich können Arbeiter*innen, bis ihre Kündigung bestandskräftig wird, weiter ihren Lohn ausgezahlt bekommen. Allerdings nur, wenn sie nach der mündlichen Kündigung ihr Interesse anmelden, bis zum Datum der Kündigung weiterarbeiten zu wollen. Dies wissen in der Regel jedoch nur diejenigen Arbeiter*innen, die sich im Arbeitsrecht auskennen oder Rechtsschutzberatung in Anspruch nehmen können. Rom*nja-Arbeiter*innen, die zum Arbeiten aus anderen EU-Ländern nach Deutschland kommen, haben aufgrund von Bildungsdiskriminierung in ganz Europa häufig weder das entsprechende Wissen noch Zugang zu Rechtsberatung. Wenn sie sich Hilfe bei Beratungsstellen holen können, ist es oft schon zu spät. Das hat zur Folge, dass sie häufig von heute auf morgen keinen Lohn mehr bekommen.
Nach der Kündigung
Die Kündigungen, die die Rom*nja im Unternehmen XY bekommen, unterstellen den Gekündigten entweder implizit oder explizit, dass der/die Gekündigte für die Kündigung verantwortlich sei. Das hat zur Folge, dass die Gekündigten, die sich innerhalb von drei Tagen bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden müssen, durch die Agentur eine Bescheinigung ausgehändigt bekommen, auf der die „freiwillige Arbeitslosigkeit“ attestiert wird. Dieses Schreiben bescheinigt den Gekündigten, dass sie die Arbeitslosigkeit freiwillig herbeigeführt haben, was in der Regel bei den Rom*nja aus der EU mitnichten der Fall ist. Die zugeschriebene Selbstverschuldung hat existentielle Folgen für die Betroffenen, denn mit der Schuldzuweisung folgt auch die Sanktion des Systems: eine dreimonatige Sperrfrist des Arbeitslosengeldes (ALG). Die Logik dahinter: Wer freiwillig seine Arbeit verlässt, benötigt das ALG nicht dringend.
Erst nach den drei Monaten Sperrfrist haben Betroffene − je nachdem wie lange sie beschäftigt waren − Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Wenn die Agentur für Arbeit in dieser Zeitspanne Vermittlungsvorschläge machte, fanden die gekündigten Rom*nja Arbeiter*innen meist darüber keinen neuen Job, weil die neuen Arbeitgeber ausreichende Deutschkenntnisse verlangen, die häufig nur eingeschränkt vorliegen. Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass viele Arbeitsstellen zu weit entfernt liegen. Daraufhin können Betroffene zwar theoretisch einen Antrag auf ALG II (seit 1. Januar 2023 Bürgergeld) stellen, der ist aber häufig sehr langwierig, da bis zu 50 verschiedene Dokumente abgefragt werden, die Betroffene teilweise nur mit Übersetzer*innen bzw. unter erschwerten Bedingungen bekommen. Nicht selten kommt ein Bescheid oder eine Ablehnung erst mehrere Wochen später.
Ohne Arbeitslosengeld oder Folgearbeitsverhältnis dreht sich die Schuldenspirale erstmal stetig abwärts. Nach kurzer Zeit türmen sich bei den gekündigten Arbeiter*innen Rechnungen, Abmahnungen und Räumungsklagen. Wer die Strom-Kosten nicht zahlen kann, lebt dann teilweise ohne Strom. Auch Kindergeld wird seit 2019 stellenweise von den Familienkassen nicht mehr ausgezahlt, sobald beide Eltern arbeitslos sind. Der Europäische Gerichtshof hatte zwar geurteilt, dass Kindergeld im Fall von Arbeitslosigkeit weiter ausgezahlt werden muss5, aber die Praxis der Familienkassen in den neuen Bundesländern orientiert sich offenbar nicht an diesem Urteil. Mangelnder Zugang der Betroffenen zu Berater*innen, Dolmetscher*innen sowie zu Anwält*innen führen dazu, dass praktisch niemand den Rechtsweg bestreitet. Die Prekarisierungsspirale dreht sich weiter.
Diejenigen, die mindestens ein Jahr beschäftigt waren und Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben, bekommen dieses nach der dreimonatigen Sperrzeit ausgezahlt. Doch auch das funktioniert in den neuen Bundesländern nur in seltenen Fällen reibungslos, da bei der Beantragung viele Dinge beachtet werden müssen, die die Betroffenen ohne Beratung kaum wissen können. Hinzu kommen Verständigungsschwierigkeiten. Bei Dolmetsch-Diensten handelt es sich in der Regel um eine Ermessensleistung und keine Soll-Leistung. Die Agentur für Arbeit kann zwar auf einen telefonischen Dolmetscher*innen-Pool zugreifen, Mitarbeiter*innen der Agentur bieten diese Hilfestellung ihren Kund*innen aber häufig nicht aktiv an. Auch wenn wir als Berater*innen die Dolmetschung erfragen, wird diese nicht umstandslos gewährt. Wir benötigen einen langen Atem, um den Menschen in unserer Sprechstunde externe Dolmetscher*innen in der Behörde zu ermöglichen. Diskussionen mit Mitarbeiter*innen am Telefon sind keine Seltenheit, wobei auch hier diskriminierende Aussagen fallen. Nachdem ich unlängst telefonisch bei der Agentur für Arbeit eine Türkisch-Dolmetschung erfragte, entschied die Mitarbeiter*in: „Für Ukrainer können wir da noch Dolmetscher besorgen, aber für Bulgaren oder Türken nicht”. Als ich ihr sagte, dass es sich dabei um eine Ungleichbehandlung handele, war die Mitarbeiterin erstaunt; offenbar war ihr der diskriminierende Inhalt ihrer Aussage nicht bewusst.
Behördliche Überprüfung von EU-Bürger*innen
Wer als EU-Bürger*in kürzer als ein Jahr gearbeitet hat, dem bleibt der Weg zum Jobcenter, um Bürgergeld zu beantragen. Die Anträge sind sehr aufwendig und erfordern Deutschkenntnisse oder externe Hilfestellung. Beratungsstellen sind in den neuen Bundesländern Mangelware. In der beschriebenen Kleinstadt gibt es aktuell für alle Zuwander*innen eine halbe Beratungsstelle, die teilweise online und teilweise vor Ort berät. Die Nachfrage nach Beratung ist groß. Es bräuchte mindestens zwei weitere Stellen, um die Arbeiter*innen vor Ort zu unterstützen und den Sozialberater vor dem Burnout zu schützen. Doch auch die arbeitssuchenden EU-Bürger*innen, die sich irgendwie durch die Anträge kämpfen, haben nicht unbedingt eine Chance. Denn wenn EU-Bürger*innen weniger als ein Jahr in Deutschland gearbeitet haben, stand ihnen bislang − im Gegensatz zu Beschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit − nicht automatisch eine finanzielle Absicherung durch den Staat zur Verfügung. Inwiefern sich das beim Bürgergeld ändern wird, bleibt abzuwarten; bislang ist keine Änderung in Sicht. Weiterhin prüfen die Jobcenter, aus welchen Gründen es zu dem Jobverlust kam, und ob die EU-Bürger*innen die Arbeitslosigkeit vielleicht selbst verschuldet haben. Durch die Regelung soll, so die Begründung, „Sozialtourismus“ verhindert werden. Denn wer selbst verschuldet seinen Job verloren hat und in diesem, nach Ankunft in Deutschland, nur kurz gearbeitet hat, wird durch die Behörde verdächtigt, nur pro forma den Job angenommen zu haben, um danach von Sozialleistungen zu leben.
Tatsächlich kann das Jobcenter die Anträge von Menschen mit bulgarischer und rumänischer Staatsangehörigkeit gesondert überprüfen. Rechtliche Grundlage ist eine 30-seitige Arbeitshilfe zur „Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch im spezifischen Zusammenhang mit der EU-Freizügigkeit“ (früherer Titel: „Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch durch EU-Bürger“). Die Arbeitshilfe trägt den Zusatz „Nur für den Dienstgebrauch“ und ist durch die Bundesagentur für Arbeit nicht veröffentlicht worden, da ihr Bekanntwerden nach offizieller Auffassung „die öffentliche Sicherheit” gefährden könne. Ziel der Arbeitshilfe ist laut der Bundesagentur für Arbeit, „Missbrauch von Sozialleistungen“ aufgrund einer „Vortäuschung des Arbeitnehmerstatus“ durch Unionsbürger*innen zu erkennen. Und damit wären wir wieder beim Vorurteil des „Sozialleistungsmissbrauchs” angekommen. Das Vorurteil, das hier in behördliche Formeln gegossen ist, wirkt diskriminierend und rassistisch, weil nur Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, also explizit Unionsbürger*innen, davon betroffen sind. In früheren Fassungen der Arbeitshilfe waren zudem bestimmte Staatsangehörigkeiten und ethnische Gruppen als „verdächtig“ aufgelistet: „Hier sind insbesondere rumänische und bulgarische Staatsangehörige zu nennen. Häufig gehören diese in ihrem Heimatland türkischsprachigen Minderheiten an“6. Problematisch an der Arbeitshilfe ist, dass sie die Opfer ungeschützter und schlecht bezahlter Beschäftigungs- und Ausbeutungsverhältnisse zu Täter*innen umdefiniert. Leistungsberechtigte EU-Bürger*innen mit geringem Einkommen werden hier pauschal verdächtigt, Leistungen zu erschleichen oder werden sogar zu Mitgliedern „krimineller Banden“ umgedeutet. Unter den leistungsberechtigten EU-Bürger*innen mit geringem Einkommen befinden sich viele Rom*nja aus Bulgarien und Rumänien.
Wer eine Ablehnung vom Jobcenter erhält, muss in der Regel seinen Krankenversicherungsschutz und den für die Kinder selbst bezahlen. Doch wer kein Geld hat, kann keine Krankenversicherung bezahlen. Im Falle prekarisierter EU-Bürger*innen leben diese unter bestimmten Umständen ohne Krankenversicherung in Deutschland. Es gibt Initiativen und Vereine, die denjenigen helfen, die sie kennen. Hilfe bieten beispielsweise Clearingsstellen für Menschen an, die derzeit keinen regulären Zugang zum Gesundheitssystem haben. Sie vermitteln zwischen Betroffenen und Krankenkassen und unterstützen Betroffene dabei, Kostenträger zu finden und eine Anbindung an die Regelversorgung zu erreichen. Solange kein Versicherungsschutz besteht, organisieren Mitarbeiter*innen ärztliche Behandlungen anonym, vertraulich und kostenfrei. Auch Polikliniken bieten kostenfreie anonyme medizinische Konsultationen an. Doch der Bedarf nach Beratung und ärztlicher Behandlung ist hoch, kooperierende Ärzt*innen gibt es auch im urbanen Raum nur wenige. Ein tragfähiges Konzept in diesem Zusammenhang hat die Stadt Dortmund entwickelt. Dort bietet das Gesundheitsamt der Stadt täglich kostenfreie Sprechstunden für Kinder an7. Sprachmittler*innen arbeiten vor Ort und dolmetschen für die Patient*innen bei Bedarf.
Viele der Betroffenen geben trotz der erschwerten Bedingungen nach der Kündigung nicht auf. Viele sind überzeugt, dass sie in ihrem Herkunftsland keine Arbeit finden werden. Sie warten. Durch die Deutschkurse für die ukrainischen Geflüchteten konnten in Ausnahmefällen auch einige wenige Rom*nja- Arbeiter*innen niedrigschwellige Deutschkurse wahrnehmen. Reguläre Deutsch- und Integrationskurse müssen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder über freie Träger*innen beantragt werden. Sind die Beantragungen erfolgreich, müssen die Kurse regelmäßig wochentags am Vormittag besucht werden. In dieser Zeit können die Menschen nicht arbeiten. Doch dies ist die Voraussetzung, um das Recht auf Freizügigkeit weiter ausüben zu können.
Entzug der Freizügigkeit
Wenn EU-Bürger*innen nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit keine neue Arbeit gefunden haben, kann ihnen die Ausländerbehörde das Recht auf Freizügigkeit entziehen (§ 7 FreizügG/EU). Damit verweigert auch das Jobcenter Leistungen. Auch andere Sozialleistungen für die Kinder der Betroffenen entfallen dann. Ein Anspruch auf z.B. Unterhaltskostenvorschuss oder Leistungen für Bildung und Teilhabe besteht dann nicht mehr. Genau diese Erfahrungen machen viele der Rom*nja- Arbeiter*innen in den neuen Bundesländern.
Der Entzug der Freizügigkeit wird in manchen Städten im Bundesgebiet schon routinemäßig praktiziert, ohne dass dies öffentlich thematisiert wird. In Hamburg beispielsweise wurde zwischen 2017 und 2022 insgesamt 884 EU-Bürger*innen die Freizügigkeit entzogen, das heißt, sie mussten ausreisen oder wurden abgeschoben. In den meisten dieser Fälle handelte es sich um obdachlose Menschen8.
Wenn eine Rom*nja-Familie in den neuen Bundesländern ihre Wohnung durch eine Räumungsklage verliert und obdachlos wird, gibt es praktisch keine Auffangstruktur für sie. Die wenigen noch nicht wegrationalisierten Plätze für Obdachlose sind nur kinderlosen Erwachsenen vorbehalten. Droht einer Familie die Obdachlosigkeit, kann sehr schnell das Jugendamt vor der Tür stehen, die Kinder dürfen nicht auf der Straße leben. In diesen Fällen droht den Betroffenen nicht nur der Verlust ihrer Arbeit, sondern auch ihrer Kinder. Aus Sorge vor traumatisierenden Erfahrungen machen sich diese Betroffenen unter Umständen wieder auf den Heimweg.
Eine neue Familie wartet schon auf ihre leer gewordene Wohnung. Sie brauchen dringend Arbeit. Was die Menschen nicht mitnehmen können, stellen sie vor die Tür. Ein gefundenes Fressen für die lokalen Medien und all diejenigen, die den Stadtteil der Kleinstadt immer wieder als Problemviertel darstellen. Weshalb Menschen ihre Möbel vor die Tür stellen, danach fragt sie keiner, weder die Anwohner*innen noch lokale Medienmacher*innen. Im letzten Jahr wurden wir als ein Interessenverband der Rom*nja und Sinti*zze zwar von unterschiedlichen Medienmacher*innen interviewt, die in einem Fall auch mit betroffenen Rom*nja sprachen, berichtet hat aber letztlich niemand über die eigentlichen Zustände.
Die Kluft zwischen Vorurteil und Realität
Die dargestellten Zustände verdeutlichen die Einseitigkeit des Begriffs des „Sozialtourismus“, der pauschal gegenüber Rom*nja Anwendung findet, obwohl die unterschiedlichen Gruppierungen der Rom*nja alles andere als Urlaub in der BRD machen und „auf der faulen Haut“ liegen, wie der Begriff suggeriert, sondern hier häufig Schwerstarbeit verrichten. „Sozialtourismus“ ist deshalb ein rassistisches Tarnwort, weil es eine ethnische Minderheit pauschal abwertet und kriminalisiert. Es lenkt den Blick weg von der Struktur der Prekarisierung, denen Unionsangehörige Rom*nja in Deutschland häufig ausgesetzt sind. Mit sozialpolitischen Strategien wie dem internen Arbeitspapier der Bundesagentur für Arbeit, die das Vorurteil bewusst am Leben erhalten, werden zudem Opfer pauschal zu Täter*innen umdefiniert. Des Weiteren ignoriert das Vorurteil, dass diejenigen, die pauschal verdächtigt werden, einen nicht unerheblichen Beitrag zur Volkswirtschaft der hiesigen Gesellschaft leisten. So tragen Rom*nja, die als Unionsangehörige in Deutschland arbeiten, mit ihrem Einkommen u.a. auch zum Erhalt der Sozial- und Rentenkassen bei. Die Unterstellung des „Sozialtourismus“ trägt überdies zum Entwurf einer Zweiklassengesellschaft innerhalb der Unionsgemeinschaft bei, weil sie ausschließlich gegenüber neuen Unionsangehörigen greift. Anstatt Begriffe wie „Sozialtourismus“ und „Armutszuwanderung” zu bedienen und damit rechtspopulistische Tendenzen zu stärken, ist es an der Zeit, Strategien zu entwickeln, die zum Abbau solcher Vorurteile führen. Es ist an der Zeit eine Politik zu fördern, die zur Entspannung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Rom*nja beiträgt, anstatt ihnen sozialpolitische Riegel vorzuschieben.
1Zur Arbeitsmigration in die deutsche Fleischindustrie siehe online: https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/migration-in-staedtischen-und-laendlichen-raeumen/325067/migration-und-arbeit-in-der-fleischindustrie/
2Der Fleischatlas Regional Sachsen online: https://weiterdenken.de/sites/default/files/fleischbeileger_sachsen_web.pdf
3Im Text wurde das Unternehmen, um das es sich handelt und dessen Namen uns bekannt ist, anonymisiert. Wir haben uns dazu entschieden, um die betroffenen Arbeiter*innen, die von den Arbeitsbedingungen berichtet haben, zu schützen.
4Quelle online: https://www.slpb.de/themen/gesellschaft/migration-und-integration/migration-in-sachsen
5Siehe online: https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/eugh-arbeitslose-eu-auslaender-haben-anspruch-auf-kindergeld-fuer-ihre-im-heimatstaat-lebenden-kinder
6Dazu publiziert in regelmäßigen Abständen der Sozialhilfe- und Erwerbslosenverein Wuppertal, der das Dokument auch geleakt hat. Online: https://tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/archiv/neune-arbeitshilfe-bekaempfung-von-bandenmaessigem-leistungsmissbrauch-im-spezifischen-zusammenhang-mit-der-eu-freizuegigkeit.html
7Online : https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/gesundheitsamt/kinderundjugendliche/sprechstunde_nicht_krankenversicherter_kinder/index.html
8Siehe Kovacheva, Vesela (2020). Der Umgang mit EU-Bürger*innen mit Unterstützungsbedarf in Hamburg: lokale Antworten auf transnationale Herausforderungen. Diskussionspapier der Diakonie Hamburg. Online: https://www.diakonie-hamburg.de/export/sites/diakonie/.galleries/downloads/Fachbereiche/WD/LV_WD_11_0005_Studie-EU-Buerger_K4.pdf