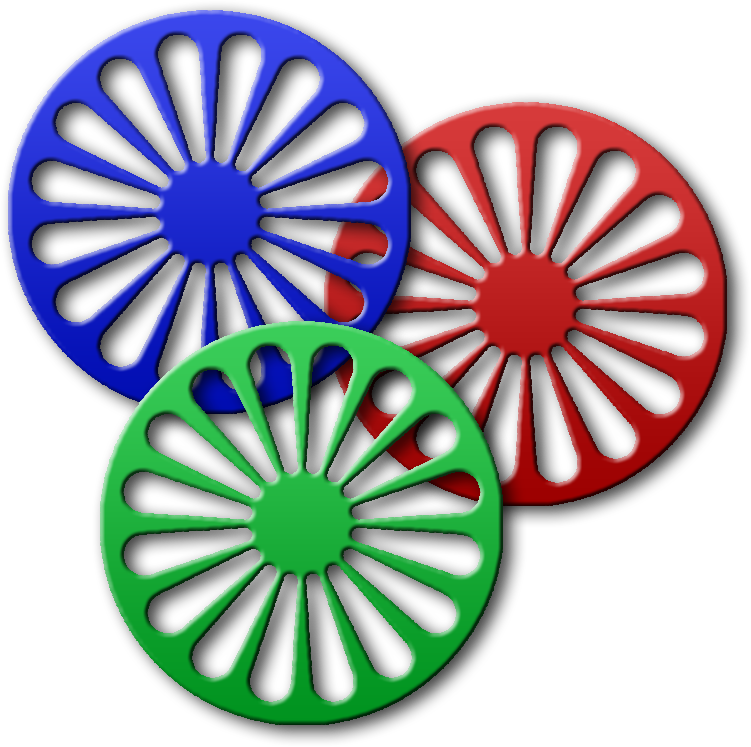Romn*ja und Sinti*zze erfahren deutschlandweit Diskriminierung. Wie und wo macht sich das heute bemerkbar?
Erschienen in: Roma und Sinti in Sachsen: Eine vergessene Minderheit? Leipzig: Romano Sumnal e.V., 8. April 2023
von Iovanca Gaspar

Romn*ja und Sinti*zze erfahren deutschlandweit Diskriminierung. Wie und wo macht sich das heute bemerkbar? Welche Ursachen hat Diskriminierung? Welche Rolle spielen Sprache und Bildung dabei? Und was können wir dafür tun, dass wir in einer Gesellschaft ohne Diskriminierung gegen Romn*ja und Sinti*zze leben? Viele Fragen und einige Vorschläge.
Diskriminierung bezeichnet die Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen. In Deutschland sind wir – Rom*nja und Sinti*zze – davon in besonderem Maße betroffen, und dies schon seit wir in Europa leben, seit mehr als 700 Jahren. Unsere Community wird sowohl von einzelnen Personen diskriminiert, als auch von Institutionen. Die Diskriminierung auf dem europäischen Kontinent mündete für viele unserer Vorfahren sogar in Sklaverei. Dieser Fakt ist leider kaum bekannt. Dabei dauerte die Phase der Versklavung für uns lange an. 500 Jahre lebten unsere Vorfahren auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens in Unfreiheit. Die Sklaverei ist abgeschafft und im 21. Jahrhundert sollte keinem Menschen die Würde genommen werden. Doch die Realität ist leider eine andere. In vielen Ländern Europas verdinglichen sich Rom*nja gegenwärtig in Lebensmittel-Fabriken und im Hotel- und Reinigungsgewerbe und anderen Branchen, die stark von Ausbeutung betroffen sind. Das hat auch damit zu tun, dass die Chancengleichheit im Bildungssektor für Romn*ja in vielen Ländern nicht existiert und sie Arbeiten verrichten, die andere nicht machen wollen. Dabei sprechen alle von Inklusion.
Die europäische Union finanziert Projekte für Rom*nja und Sinti*zze seit mehr als 30 Jahren. Zuletzt nannte sich das europaweite Programm zur Bekämpfung von Diskriminierung und Inklusion auf nationaler Ebene „Roma Strategie“. Seit 2020 wurde die Strategie um den kürzlich verabschiedeten EU-Aktionsplan gegen Rassismus 2020-2025 erweitert. Er steht für das Bekenntnis der Europäischen Kommission zu einer Union der Gleichheit. Doch Resultate sind bislang nicht erkennbar, die Situation der Rom*nja in Europa hat sich nicht wesentlich verbessert. Ein Beispiel dafür ist die zivile Infrastruktur, wofür sehr viel Geld von der EU-Kommission nach Südost-Europa geflossen ist. Doch die Regierungen haben die Fördermittel nicht immer dorthin weitergeleitet, wofür sie eigentlich vorgesehen waren. Rom*nja leben in Ost- und Südost Europa oftmals weiterhin in desolaten Zuständen, ähnlich wie in Slums in Bangladesch oder in Afrika: ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Abwasser.
Auch deutsche Sinti*zze und Rom*nja erfahren häufig Ausgrenzung und Diskriminierung. In Sachsen ist die auf den ersten Blick oft nicht oft offensichtlich, viele Deutsche Sinti*zze und Rom*nja sich häufig nicht gleich zu erkennen geben. Beispiel für ie Diskriminierung deutscher Sinti*zze und Rom*nja zeiegn sich aber zum Beispiel in Medienberichterstattungen, wenn in Urlaubszeiten Familien mit Wohnwagen gemeinsam auf sächsischen Campingplätze kommen, um Urlaub zu machen – dies geschieht auch oft auf er Durchreise nach Tschechien. Man bemerkt es, wenn, unsere Menschen beim nachgehen ihrer Berufe und Tätigkeiten kriminalisiert und Verdächtigt werden und mit der Bezeichung Z… beschimpft werden. Besonders die jenigen Familien, die im Bereich der Kultur, Schaustellerei oder Musik tätig sind, erleben seit Beginn der Coronazeit viele Nchteile und wenig Unterstützung von Kommunaler und staatlicher Seite. Meist geschicht dies aber wie bereits erwähnt unterschwellig. Daten können kaum geammelt werden, Fälle lassen sich durch Berichte der Betroffenen oder durch Medienberichterstattung festhalten.
In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis Anfang der 90er Jahr lebten nur wenige Sinti*zze und Rom*nja auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Viele gingen nach dem Krieg in die Amerikanische und Französische Besatzungszonen andere reisten noch in den 50er und 60er Jahren aus der DDR aus zu ihren Angehörigen in die BRD. Die meisten Familien kamen erst nach der Wende wieder nach Ostdeutschland, kauften Grundstücke und Häuser, gründeten Firmen und ließen sich nieder.
In den sächsischen Großstädten sind deutsche Sinti*zze und Rom*nja oft gar nicht sichtbar. Viele von uns geben sich in der Öffentlichkeit in Sachsen nicht offen als Romn*ja und Sinti*zze zu erkennen. Wir sind auch nicht in der öffentlichen Gesellschaft vertreten – weder in etablierten gesellschaftlichen Positionen, noch in politischen Entscheidungsgremien. Das alles hat geschichtliche Gründe. Sie liegen im Rassismus begründet, der sich immer wieder auch in der Gegenwart zeigt.
Bildungsdiskriminierung
Ähnlich wie in anderen Bundesländern, werden auch in Sachsen vergleichsweise viele Kinder von Rom*nja auf Sonderschulen geschickt, dies geschieht vorallem bei zugewanderten Rom*nja aber auch bei alteingesessenen Sinti*zze und Rom*nja. Der Weg in Sonderschulen verunmöglicht Chancengleichheit auf Bildungsebene und einen einen gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung. Bislang gibt es nur wenige Fälle, in denen Betroffene sich erfolgreich gegen diese Form der Bildungsbenachteiligung zur Wehr gesetzt haben bzw. den Rechtsweg gegangen sind.1
Ein zentrale Ursache bei der Entstehung des Problems der Verteilung von Kindern auf Sonderschulen sind mhäufig die vorausgehenden Schuluntersuchungen. Sie bestehen aus Abfragen von Inhalten, die die Kinder vorallem dann wenn sie keinen Kindergarten besucht haben und in der Familie betreut wurden, noch nicht kennengelernt haben und daher auch nicht beantworten können. Da viele unsere Familien mit mehreren Generationen zusammenleben, benötigt es im Kleinkindalter keine fremde Betreuung. Diskriminierungserfahrungen, die fast jeder von uns schon gemacht hat, führen oft zu der Entscheidung, die kleinen Kindern lieber in der Familie zu betreuen.
Wenn Kinder keine Kita besucht haben, fehlen ihnen oftmals Bildungsinhalte, die hierzulande vor allem institutionell vermittelt werden, Eltern, die selbst nicht im Kindergarten waren, können dies oft nur kaum zu Hause ersetzen. Wenn die Kinder in die Schuluntersuchung kommen, können sie zwar oftmals schon mindestens zwei oder mehr Sprachen sprechen, können auch Grundrechenarten und andere Schlüslequalifikationen, haben diese aber in anderen Zusammenhängen gelernt und sind mit den Aufgabenstellungen nicht vertraut. Ein Beispiel: Bei der Begleitung einer Roma-Familie, erlebte ich, dass der Sohn bei der Schuleingangsuntersuchung nach den Teilen des Fahrrads gefragt wurde. Das Kind war bis dahin nie Fahrrad gefahren, auch die Eltern besaßen kein Fahrrad, weshalb er diese nicht kannte. Er hatte seinen Vater aber oftmals beim Reparieren von Autos beobachtet, Teile eines Autos und Motors hätte er benennen können, dies wurde aber nicht abgefragt. Das Untersuchungserbgebnis fiel dementsprechend schlecht aus.
Bei zugewanderten Rom*nja kommt hinzu, dass viele die Inhalte einer spezifischen Bildungskultur noch nicht kennengelernt haben, die hierzulande als Selbstverständlichkeit gelten. Hinzu kommt, dass ggf. Deutschkenntnisse bei ihnen nur gering ausgeprägt sind oder nicht vorhanden sind, die zudem maßgeblich dafür sind, dass das Kind die Aufgaben versteht und entsprechend beschult werden kann.
Diskriminierung und die Rolle des Romanes
Heute, in einer multikulturellen Gesellschaft, werden Muttersprachen politisch stark gefördert. Das Romanes zählt zu den von der Sprachen-Charta des Europarates geförderten Minderheitensprachen. Doch im Gegensatz zur rechtlichen Ausgestaltung, ist Romanes in den europäischen Regionen, in denen Sinti*zze und Rom*nja leben, unter der Zivilbevölkerung als Sprache oftmals gar nicht bekannt. Wenn Romn*ja und Sinti*zze ihre Muttersprache sprechen, wird es von der deutschen Mehrheitsgesellschaft häufig eher problematisiert. Während meiner Arbeit als Dolmetscherin haben mir Eltern berichtet, dass Lehrer*innen von ihnen verlangt haben, nicht Romanes mit den Kindern zu sprechen, sondern nur Deutsch. Natürlich kann es sinnvoll und integrationsfördernd sein, mit den eigenen Kindern mehr Deutsch zu sprechen. Doch eine Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern selbst sehr gut Deutsch sprechen (wenn sie zugewnadert sind) und/oder das nötige Selbstbewusstsein haben, mit ihren Kindern eine andere Sprache als ihre Muttersprache zu Hause zu sprechen. Denn sonst antworten die Kinder vermutlich auch nicht auf Deutsch, sondern in ihrer eigenen Muttersprache. Welche Sprache in bestimmten Situationen zum Einsatz kommt, wird viel von Emotionen gesteuert. In bestimmten z.B. auch schwierigen Situationen, kann es sehr wichtig sein die vertraute Muttersprache zu sprechen. Sinnvoller wäre es daher Eltern zu empfehlen nicht nur Deutsch, sondern, wenn dann öfter mal Deutsch mit ihren Kindern zu sprechen, wobei eine gleichzeitige Unterstützung die Muttersprache weiter (in geschützten Räumen) zu sprechen zielführend sein kann. Wie das gelingen kann, zeigt ist die Nordmarkt-Grundschule in Dortmund2. Die Schule, die neben engagierten Lehrkräften sehr stark auf Schulsozialarbeit setzt, bietet u.a. Sprachkurse für die Eltern ihrer Schüler*innen im Eltern-Café an ohne ihnen vorzuschreiben, welche Sprache sie zu Hause sprechen sollen. Das stärkt das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen und Eltern. Denn wenn Menschen das Gefühl haben ihre Muttersprachen nicht mehr sprechen zu dürfen, schotten sie sich eher ab. Glücklicherweise ist Romanes aber bis heute eine lebendige Sprache, die Menschen bis heute transnational miteinander verbindet.
Positive Diskriminierung
Heute leben wir in einer demokratischen Gesellschaft, in der Diskriminierung nichts zu suchen hat – weder negative noch positive Diskriminierung. Auch letztere findet häufig statt, vor allem auch dann, wenn Angehörige der Mehrheitsgesellschaft glauben, mit Rom*nja und Sinti*zze zu sympathisieren. In solchen Kontexten finden Angehörige der Mehrheitsgesellschaft traditionelle Praktiken von Minderheiten „ganz toll“. So gibt es beispielsweise die Zuschreibung, dass Rom*nja und Sinti*zze angeblich „Z…musik“ „im Blut“ liegen soll. Solche Zuschreibungen sind Ausdruck einer positiven Diskriminierung und Kulturalisierung. Auch wenn Rom*nja und Sinti*zze in den letzten Jahrhunderten gute Musik komponiert, interpretiert und improvisiert haben, die sehr gut bei einer breiten Masse ankommt, heißt das nicht automatisch, dass alle Rom*nja und Sinti*zze Musik machen, geschweige denn, dass sie ein „Musik-Gen” haben. Es heißt auch nicht, dass Musik das Einzige ist, was sie können. Auch bedeutet es nicht, dass es eine bestimmt „Z…musik“ gäbe, Die Musik die Sinti*zze und Rom*nja traditionlee spielen, ist immer auch an des Land angelehnt in dem sie leben – es gibt spanischen Flamenco, Swing, Schlager, Brassmusik und natürlich auch alle anderen Genres. Hier in Sachsen bemerken wir immer wieder, dass uns eine folkloristische Musik zugeschrieben wird, mit er auch eine bestimmte Kleidung in Verbindung gebracht wird, die gar nicht der Realität entspricht – Bunte Röcke und weiße Blusen mit bunten Tüchern sind ein Stereotyp. Dieser ist besonders in Sachsen aber sehr beliebt – bei Folklore-Festivals, Musikaufführungen und anderen kulturellen Events, treten gerne Musikgruppen auf, die vermeintlich Z…musik spielen, oder vermeintliche Z…tänze vorführen. Diese Darsteller sind keine Sinti*zze und Rom*nja, sondern versuchen nur fiktive Figuren nachzustellen. In dieser „Szene“ ist es besonders schwer gegen die Diskriminierung und den Stereotyp anzukämpfen. Oftmals wird unser Wunsch als Cancel-Culture angesehen. Ähnlich ist es auch bei Lebensmittelbezeichungen, wie Grillsaucen oder Schnitzelgerichten.
Was es zum Abbau von Diskriminierung braucht
Eine Voraussetzung für den Abbau von Diskriminierung gegen uns ist die Einbeziehung unserer Positionen und Meinungen in Angelegenheiten, die uns selbst betreffen. Es ist deshalb unabdingbar, dass wir stärker in politischen und kommunalen Gremien vertreten sind und unsere Stimmen Gehör finden.
Bis heute entscheiden noch immer Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, wie und ob Rom*nja und Sinti*zze gehört oder gefördert werden, und welche Zugänge sie zu Bildungsangeboten haben. Bis heute beschreiben sogenannte Expert*innen die Realitäten von Rom*nja, die selbst der Community nicht angehören, und auch oft keine Rom*nja und Sinti*zze persönlich kennen. Es wäre wünschenswert, wenn Rom*nja und Sinti*zze stärker für sich selbst sprechen dürften und sich selber aussuchen könnten, was sie bewegen und wie sie agieren möchten, damit sie in der Bevölkerung sichtbarer und präsenter werden. Niedrigschwellige Ansätze hierfür gibt es bereits. Dazu zählen Bildungsmediator*innen- und Lernhilfeprojekte mit Rom*nja und Sinti*zze wie sie bereits in München3 und in Hamburg4 erfolgreich angelaufen sind. Hierbei unterstützen Angehörige der Minderheit Kinder und Jugendliche aus der Community. Dabei geht es nicht immer nur um die Vermittlung von Inhalten, sondern auch von Lernmethoden. Aufgrund der langen Geschichte der Ausgrenzung, nicht zuletzt auch im Bildungssektor, nehmen Kinder und Jugendliche aus der Community Lernangebote teilweise besser von Angehörigen aus der Community selbst an. Wichtig ist, dass die Bildungsmediator*innen oder Lernhelfer*innen einen anerkannten Abschluss haben und eng mit den Eltern zusammenarbeiten.
Bildungsberater*innen aus der Community sollten auch bei Schuluntersuchungen und Testungen eingesetzt werden, um zu entscheiden, ob Kinder in Sonderschulen beschult werden oder nicht. Wie oben dargestellt können Bildungsmediator*innen aus der Community zwischen psychologischen Gutachter*innen und Pädagog*innen sprachlich und kulturell vermitteln und erläutern welches Vorwissen das Kind aus seiner Familie mitbringt, um letztlich die Ergebnis der Testungen bildungsgerechter zu bewerten.
Ohne uns kann der Abbau von Diskriminierung nicht gelingen, denn wir sind diejenigen, die sie erfahren. Nur mit dem Wissen unserer Erfahrungen und der Verbreitung dieses Wissens können Maßnahmen gegen Diskriminierung nachhaltig Wirkung entfalten!
1Ein erfolgreicher Rechtsstreit, der zugunsten des Klägers ausfiel, den das Schulamt zu Unrecht in eine Sonderschule eingewiesen wurde, ist der Fall des Kölner Nenad M. Mehr dazu siehe URL : https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-streit-um-koelner-foerderschueler-beendet-117763?cb=1672823578131, zuletzt abgerufen am 04.01.23
2Mehr zum Konzept der Dortmunder Nordmarktschule unter: https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_0004785 und https://www.youtube.com/watch?v=QFGvcV7o3kU, zuletzt abgerufen am 04.01.23
3Siehe Interview S.8-10 „Es waren so viele, dass der Platz im Raum nicht ausreichte“ http://raa-berlin.de/wp-content/uploads/2014/11/bildungsaufbruch.pdf, zuletzt abgerufen am 04.01.22,
4https://taz.de/Bildung-von-RomnjaSiehe URL: —und-Sintize/!5824075/, zuletzt abgerufen am 04.01.22